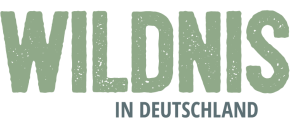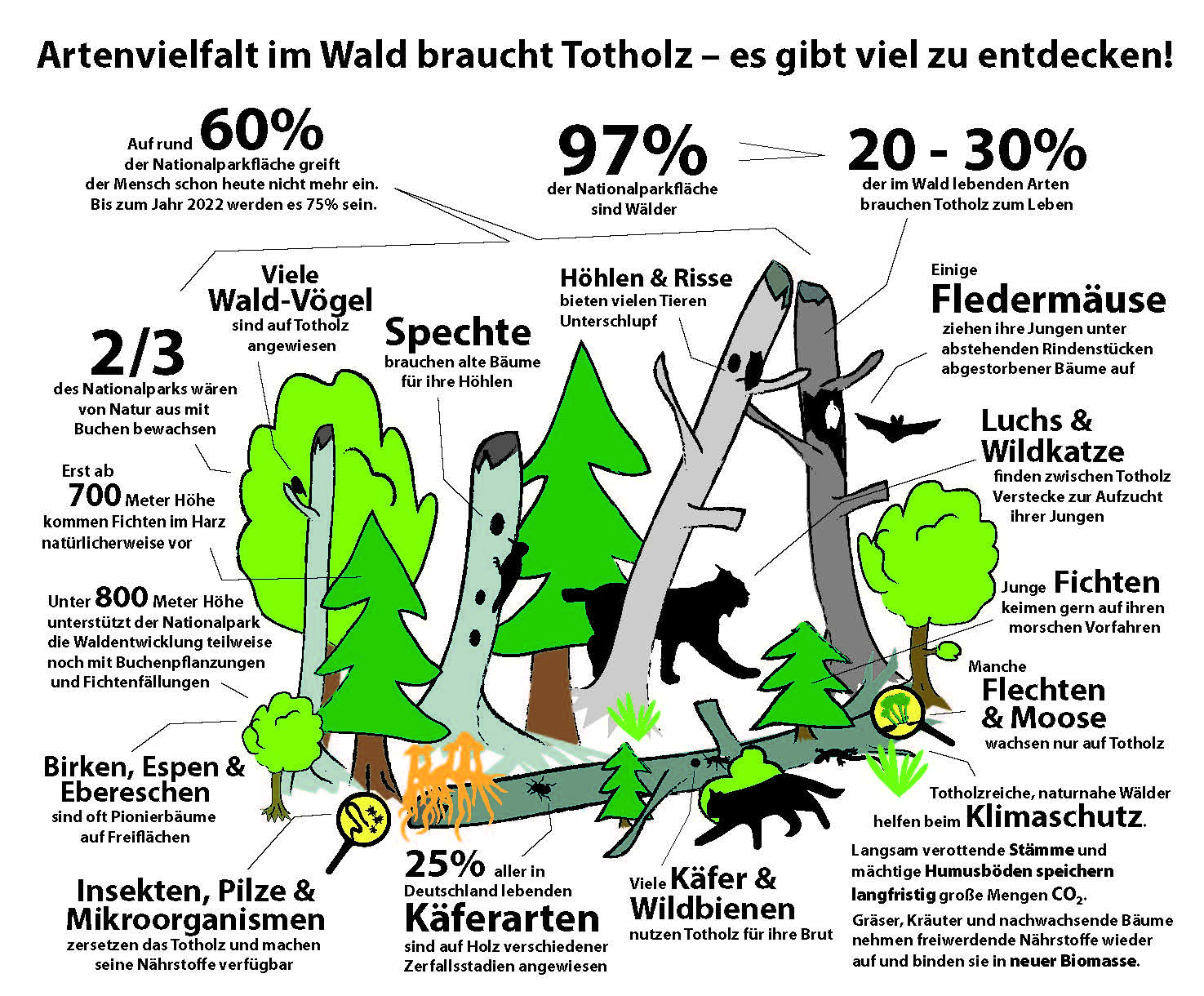Studie zeigt: Deutschland hat zu wenige Naturwälder
Erreicht die Bundesregierung ihr selbst gestecktes Ziel, fünf Prozent der Wälder bis 2020 aus der forstwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen? Eine neue Studie im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz sagt Nein. Aktuell betrage der Anteil der Naturwälder in Deutschland nur 2,8 Prozent.
Für den BUND stellt die Bilanz zum Anteil der Naturwälder ein Armutszeugnis für Deutschland dar. Gemeinsam mit anderen Naturschutzverbänden fordert der BUND ein Programm zur Förderung und Sicherung von Naturwäldern auf den Weg zu bringen, in das Bund, Länder und Kommunen einbezogen werden.
NABU-Präsident Olaf Tschimpke erkennt die Bemühungen einiger Bundesländer wie Baden-Württemberg, Hessen oder Thüringen zwar an, Wälder unter Schutz zu stellen, aber meist seien die ausgewiesenen Waldgebiete zu klein.
Die Pressemitteilungen und weitere Informationen zur natürlichen Waldentwicklung in Deutschland finden Sie hier:
Pressemitteilung Bundesamt für Naturschutz und Nordwestdeutsche Forstliche Versuschsanstalt
Pressemitteilung NABU
Pressemitteilung BUND
Infos zur aktualisierten Bilanz der Bundesweiten NWE-Kulisse (NWE= natürliche Waldentwicklung)
In der Initiative „Wildnis in Deutschland“ haben NABU Hessen, BUND Hessen, HGON, ZGF, Greenpeace und WWF Deutschland bereits 2018 25 Vorschläge für große Waldschutzgebiete in einem Konzept vorgelegt, um das fünf Prozent Ziel im Bundesland Hessen zu unterstützen.