Traumjob Meeresschützer: Interview zum 40-jährigen Jubiläum des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
Im Gespräch: Hans-Ulrich Rösner

© Annkatrin Weber-Gerlach
Sie waren bis vor kurzem Leiter des Wattenmeerbüros des WWF Deutschland in Husum, und sind jetzt ins Ehrenamt gewechselt. Seit über 40 Jahren sind Sie als Naturschützer für das Wattenmeer aktiv. Wie kam es dazu?
Als Kind durfte ich mehrfach im Wattenmeer, auf der schönen Insel Wangerooge, Urlaub machen. Ich begeisterte mich fürs Muschelsammeln am Strand und für Krebse. Schon damals stand für mich fest, dass ich Biologie studieren würde. Nach meinem Studium leistete ich dann Zivildienst bei der Schutzstation Wattenmeer auf der Insel Pellworm. Das war enorm lehrreich und spannend, sodass ich die Chance ergriff, danach im Wattenmeerbüro des WWF in Husum eine Stelle anzutreten.
Viele Wattflächen sind genauso Wildnis, wie es ein Urwald ist, es ist nur eben ein völlig anderes Ökosystem.
Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer feiert dieses Jahr 40-Jähriges Bestehen. Sie haben die Ausweisung zum Nationalpark miterlebt. Bevor das Gebiet zum Nationalpark ausgewiesen wurde, war das Gebiet bereits Naturschutzgebiet „Nordfriesisches Wattenmeer“. Was hat sich durch die Ausweisung zum Nationalpark verändert?
Ein Nationalpark hat ein klares Schutzziel, nämlich „Natur Natur sein lassen“. Zudem muss auf dem weitaus größten Teil der Fläche eines Nationalparks eine ungestörte Naturentwicklung stattfinden. Das Wattenmeer eignet sich dafür hervorragend, denn es ist noch sehr naturnah. Es ist auch sehr groß und vielfältig, sodass eingreifende Management-Maßnahmen, zum Beispiel für den Artenschutz, im Nationalpark nur als Ausnahme erforderlich sind. Ein zweiter Punkt ist aber auch sehr wichtig, denn ein Nationalpark hat einen sehr hohen Stellenwert in der Öffentlichkeit. Auch im internationalen Kontext wird er mit geschützter Natur verbunden. Dies stärkt den Schutz im Nationalpark, was angesichts der vielen Nutzungsinteressen, die sich auf das Wattenmeer richten, beispielsweise Fischerei, Energieinfrastruktur oder Tourismus, auch sehr notwendig ist.
Oftmals gibt es großen Widerstand gegen die Ausweisung eines neuen Nationalparks. Sie haben miterlebt, was 40 Jahre Nationalpark für eine Region bedeuten. Wie stehen die Leute vor Ort heute dem Nationalpark gegenüber?
Vor der Ausweisung des Nationalparks war die Ablehnung in der Region sehr groß. Das wurde besonders deutlich auf einer Insel wie Pellworm, auf der ich damals lebte. Die Insel ist vom Nationalpark umgeben und die Menschen hatten die Befürchtung, dass vieles dann verboten werden würde. Es zeigte sich, dass dies übertrieben war, aber es ging eben um eine große Änderung in der eigenen Heimat, vor der man sich zunächst fürchtet. Dass muss man menschlich auch verstehen. Entscheidend ist aber, dass sich diese Einstellung an der Nordseeküste gewaltig verändert hat. Der Nationalpark Wattenmeer, eigentlich sind es ja drei Nationalparke – in Schleswig-Holstein, Hamburg und in Niedersachsen – findet heute sehr viel Zustimmung. Das liegt auch daran, dass geschützte Natur die Grundlage des Tourismus an der Nordseeküste ist und Tourismus in weiten Bereichen der wichtigste Wirtschaftszweig. Es hat aber auch mit einem Stolz auf die Natur vor der eigenen Haustür zu tun, über deren hohen Wert man sich heute viel bewusster ist als vor 40 Jahren.
Sie sind dem Wattenmeer offensichtlich sehr verbunden. Können Sie uns an Ihrer Faszination für das Wattenmeer teilhaben lassen?
Das Wattenmeer ist ein zutiefst beeindruckender Ort. Allein die unglaublich vielen Wat- und Wasservögel, die das Wattenmeer im Laufe eines Jahres nutzen, sind beeindruckend: rund eine Million brüten hier und rund zehn Millionen kommen als Gastvögel, die auf ihrem Weg aus der Arktis im Wattenmeer halt machen.
Weg vom Deich in den Salzwiesen, Stränden, Dünen oder Wattflächen ist es zudem ziemlich wild. Man kann dort erleben, wie sich die Natur dynamisch entwickelt, wozu Ebbe und Flut entscheidend beitragen. Für eine natürliche Entwicklung des Wattenmeeres gibt es zwar auch viele Einschränkungen, wie Deiche, Schifffahrt, Fischerei, eingeschleppte Arten oder den durch die Klimakrise beschleunigten Meeresspiegelanstieg. Aber im europäischen Vergleich ist der Level an Wildnis schon ziemlich hoch. Viele Wattflächen sind genauso Wildnis, wie es ein Urwald ist, es ist nur eben ein völlig anderes Ökosystem.
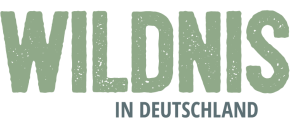






 © Daniel Rosengren
© Daniel Rosengren