Unterwegs in der Wildnis: Mit der Moorkiekerbahn ins Aschhorner Moor
Wann ist ein Moor ein Moor?
24. Juli 2025 / von Claudia Weigel
Asselermoor, FC Moor, Ritschermoor, Moor-Kartoffeln, Gauensiekermoor – überall Moor im Namen und doch kein Moor zu sehen. Das ist mein erster Eindruck auf dem Weg zur Moorkiekerbahn im Aschhorner Moor. Stattdessen fahre ich vorbei an lang gezogenen Ackergrundstücken mit Klinker- und Bauernhäusern.
Das Moor versteckt sich gut. Und die Moorkiekerbahn auch. Nur ein kleines touristisches Hinweisschild weist direkt am Abzweig von der Straße in Richtung Gelände des Euflor Humuswerks. Vor dem Werksgelände führt ein rasenbewachsener Fußweg in den Wald hinein. Wenige Schritte später sind die schmalen Schienen der Moorkiekerbahn zu sehen. Noch bis letztes Jahr wurden die Schienen hauptsächlich dafür genutzt, den Torf aus dem Gelände zum Humuswerk zu bringen. Mehrere Schautafeln weisen nun darauf hin, dass hier Naturgeschichte erlebt werden kann. Willkommen bei der Moorkiekerbahn im Aschhorner Moor!
Die Geschichte eines Hochmoores in Deutschland: Vom Torfabbaugebiet zum Wildnisgebiet
Laut Umweltbundesamt sind rund fünf Prozent der Gesamtfläche Deutschlands eigentlich Moore. Das entspricht 1,8 Millionen Hektar, jedoch sind rund 90 bis 95 Prozent davon entwässert. Auch der hiesige Kehdinger Moorgürtel, der sich nördlich der niedersächsischen Stadt Stade über rund 22 Kilometer erstreckt, ist größtenteils entwässert, und die Fläche wird von Menschen genutzt.
Schon vor 2000 Jahren gab es die ersten Torfstecher, die den Torf als Brennstoff nutzten. Vor etwa 250 Jahren begannen Landarbeiter, die am Rande des Moores siedelten, unter allergrößten Mühen die Moorflächen zu kultivieren. „Dem Ersten sein Tod, dem zweiten seine Not, dem dritten sein Brot“ beschreibt die Mühen, mit denen die Besiedler dem Hochmoor Nahrung abrangen.
Wie ich bei meiner Anreise bereits sehen konnte, ist der Kehdinger Moorgürtel auch heute noch landwirtschaftlich geprägt. Und im Aschhorner Moor wurde bis 2024 noch Torfabbau betrieben. Die Euflor Humuswerke verkaufen den Torf vor allem für die Nutzung im Garten- und Landschaftsbau.
2021 kaufte die Deutsche Wildtier Stiftung mithilfe des Wildnisfonds rund 470 Hektar im Aschhorner Moor. Abgekauft wurden einerseits Flächen, andererseits auch die Nutzungsrechte beziehungsweise Abbaurechte, um den Torfabbau vorzeitig zum Jahr 2024 zu beenden. Das Humuswerk hatte zudem noch während der Betriebszeit mit der Wiedervernässung der Flächen begonnen. Im Aschhorner Moor darf sich Natur nun bald wieder frei und ohne direkten menschlichen Einfluss entwickeln. Damit ist das Gebiet auf dem Weg zur Wildnis.
Tuckern, kiecken, snacken
Heterogen ist damit auch das Bild, das sich aus der Moorkiekerbahn heraus präsentiert. Rund vier Kilometer werden die Gäste der Moorkiekerbahn durch das Gelände des ehemaligen Torfabbaugebiets gefahren. Vorne tuckert lautstark die Diesellok, hinten sitzend höre ich das melancholische Rattern der Bahnschwellen. Im Schritttempo geht es vorbei an der Lagerstätte des Humuswerks, an Sumpfgelände, kleinen Birkenwäldern, Renaturierungsflächen, Tümpeln und offenen Landschaften. Immer wieder halten wir an und lernen vom Diplom-Biologen, der ehrenamtlich im Verein zur Förderung von Naturerlebnissen tätig ist, mehr über die Entstehung von Nieder- und Hochmoor, verschiedenen Torfarten, den Ablauf der Wiedervernässung und über Flora und Fauna im Gebiet.
Moorleichen, eingelegte Gurken und Torf
Besonders viele Nachfragen gibt es zu Moorleichen. Doch auch anhand derer kann man im Vergleich zu eingelegten Gurken gut erklären, was ein Moor ausmacht: Es ist sauer (ein pH-Wert wie Zitronensaft!), sauerstoffarm und dauerhaft nass – und konserviert daher besonders gut. Nicht nur Moorleichen werden daher schlecht zersetzt, auch Torfmoose, Schilf, Seggen oder Wollgras verrotten nach dem Absterben unter diesen Bedingungen nur teilweise. Und so entsteht die dicke organische Schicht, die Torf genannt wird. Torf ist ein weiteres wichtiges Merkmal für Moore. Die organische Schicht, aus der Torf besteht, ist der Grund dafür, warum Moore besonders gute CO2-Speicher sind.
Je länger wir im vielgestaltigen Gelände unterwegs sind, umso mehr frage ich mich, wie sieht so ein Moor eigentlich aus? Und werde überrascht, weil es sich genau dort in annähernder Form findet, wo ich anfangs nur einen Wald sehe.
An der letzten Station des Rundkurses halten wir an der Jungclausheide. Ein Holzsteg führt vorbei an überdachten Holztischen und hinein in ein waldiges Gelände, das nach ein paar hundert Metern in kleine Bäume, Büsche und Heide übergeht. Dort lenkt der Biologe unseren Blick auf den Boden: er erklärt uns Moosbeere, Sonnentau und Torfmoose.
Wunderpflanze Torfmoose
Torfmoose sind wahre Wunderpflanzen. Sie sind wurzellos, können kleinste Mengen Mineralsalze aus der Luft ziehen und machen ihren Konkurrenten das Leben schwer, indem sie ein saures Milieu schaffen. Ein wenig Torfmoos in der Hand zerdrückend, zeigt uns unser Guide zudem ihre Superkraft: Sie können mehr als das 30-fache ihres Trockengewichts an Regenwasser speichern. Weiterhin wachsen sie fast unbegrenzt: Während die Moose unten absterben, wachsen sie gleichzeitig oben weiter – rund einen Millimeter pro Jahr. Lässt man sie in Ruhe, entsteht so über Jahrhunderte bis Jahrtausende eine dicke Torfschicht und bei den entsprechenden Bedingungen ein Hochmoor.
Hüpfend demonstriert uns der Biologe dann auch, was wissenschaftlich als Schwingrasen bekannt ist. Mehrere Meter um ihn herum schwingt der Boden sanft mit. Die Moorkieker-Gäste erinnert das an ein Wasserbett. Und nichts anderes ist es auch: Unter der Schicht aus Moosen und Pflanzen befindet sich Wasser.
Wenige Meter weiter, ist die Situation eine ganz andere. Vom festen Waldboden aus schiebt er einen langen Holzstab durch die Moos- und Pflanzenschicht neben sich – das Moor ist hier in einem Übergangsstadium. Hier zeigt sich auch, wie einfach es bei Unwissenheit ist, zur Moorleiche zu werden. Ähnlich wie beim Einbruch ins Eis hätte man es hier schwer, wieder aus dem Moor herauszukommen – schafft man es nicht, würde man an Unterkühlung sterben.
Was wir hier im Aschhorner Moor erleben, sind Moore in verschiedenen Stadien. Ob es tatsächlich wieder zu einem Hochmoor werden wird, ist jedoch offen. Die wichtigste Grundvoraussetzung ist durch den Kauf der Deutschen Wildtier Stiftung jedoch geschaffen: Sind die Renaturierungsmaßnahmen abgeschlossen, wird die Natur in Ruhe gelassen, kann sich ungesteuert entwickeln – und das dauerhaft.
Wildnis und natürlicher Klimaschutz
So besteht die Chance, dass auch das Aschhorner Moor von einer CO2-Quelle wieder zu einem CO2-Speicher werden kann. Über Jahrhunderte wurde das Moor entwässert und Torf abgebaut. Das heißt, CO2 wurde freigesetzt. Auf ganz Deutschland bezogen stammen sieben Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland aus entwässerten Mooren. Moore wieder entstehen zu lassen, ist also ein wichtiger Beitrag zum natürlichen Klimaschutz in Deutschland.
Nach rund dreistündiger Fahrt und Führung durch das Gelände tuckern wir nach der beeindruckenden Vorführung des Schwingrasens und des Zwischenmoors langsam zurück. Kurz irritiert sind wir, als unser Guide – der gleichzeitig der Zugführer ist – von der Lok absteigt und vorneweg läuft. Dann zeigt sich: Hier ist alles noch Handbetrieb. Nachdem er die Weiche gestellt hat, steigt er wieder ins Führerhäuschen und fährt uns zurück in den beschaulichen Moorkieker-Bahnhof. Auf nachwirkende Weise sind die dortigen Schautafeln bei der Rundfahrt lebendig geworden: ein großes Danke an den Verein zur Förderung von Naturerlebnissen.
Eine Portion Wildnis in Ihr E-Mail-Postfach?
Abonnieren Sie den Newsletter der Initiative Wildnis in Deutschland, um mehr über Wildnis in Deutschland zu erfahren. Sie interessieren sich für Wildnis und Natürlichen Klimaschutz oder möchten mehr über Wildnisförderung erfahren? Abonnieren Sie den Newsletter der KlimaWildnisZentrale.
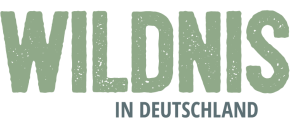







































 © Tilo Geisel/Roland Lehmann
© Tilo Geisel/Roland Lehmann