Traumjob „Wildniszertifizierer“
Im Gespräch mit Dr. Eick von Ruschkowski

Dr. Eick von Ruschkowski (rechts) bei der Übergabe des IUCN-Zertifikats für die Königsbrücker Heide © Dr. Torsten Bittner/NSG-Verwaltung Königsbrücker Heide
Herr Ruschkowski, Sie sind in Ihrem Hauptberuf Direktor der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz. Gleichzeitig sind Sie ehrenamtlich für die International Union for Conservation of Nature (IUCN) tätig und zertifizieren Wildnisgebiete. Was genau macht man als „Wildnis-Zertifizierer“?
Die Zertifizierungsaufgaben sind mit meiner Mitgliedschaft in der World Commission on Protected Areas (WCPA) der IUCN verbunden. Es handelt sich dabei auch streng genommen um keine Wildniszertifizierung, sondern eine Überprüfung, inwieweit ein Schutzgebiet die Qualitätsanforderungen der IUCN einhält. Die Aufgabe als „Wildnis-Zertifizierer“ ist es, die Einhaltung der Qualitätsanforderungen zu prüfen.
Welche Qualitätsanforderungen gibt es?
Das Handbuch Guidelines for Applying Protected Area Management Categories enthält das System der IUCN zur Klassifizierung von Schutzgebieten, unter anderem nach Schutzzielen und dem Gebietsmanagement. Das System ist sechsstufig, wobei die Kategorie I in zwei Subkategorien unterteilt ist: Ia als strict nature reserve, das gar nicht betreten werden darf, und Kategorie Ib, das Wildnisgebiet (wilderness area), das beispielsweise für Erholungszwecke betreten werden darf. Für jede Managementkategorie gibt es dann wiederum Qualitätsanforderungen und es ist meine Aufgabe, diese in Deutschland zu prüfen.
Wie läuft solch eine Schutzgebietsprüfung ab?
Die Tätigkeit ist nicht nur auf Wildnisgebiete beschränkt. Am Anfang steht immer die Anfrage eines Schutzgebietes, für eine bestimmte Kategorie zertifiziert zu werden. In einem Vorgespräch versuche ich dann auf den Grund zu fühlen, warum die Zertifizierung erwünscht ist und inwieweit am Anfang bereits erkennbar ist, ob die Zielvorstellung mit den Vorgaben der IUCN in Einklang zu bringen ist. In Deutschland habe ich 2023 das Naturschutzgebiet Königsbrücker Heide als IUCN Kategorie Ib zertifiziert, und hier war zu Beginn durchaus mit der IUCN zu klären, ob ein ehemals intensiv durch militärische Nutzung menschlich überprägtes Areal grundsätzlich überhaupt für die Kategorie Ib in Frage kommt.
Wie geht es dann weiter?
Im zweiten Schritt fordere ich dann Unterlagen des Schutzgebietes an, die mir ermöglichen, die jeweiligen Kriterien zu überprüfen. Manche davon hören sich für Mitteleuropa vielleicht eher banal an, beispielsweise die Anforderung an alle Schutzgebiete, dass sie klar definierte Flächen mit einer nachvollziehbaren Karte und rechtlich verankert sind. Die Kriterien gelten aber weltweit, sodass die Ausgangsbedingungen außerhalb von Europa völlig anders sein können. Als Nächstes steht dann nach Möglichkeit ein Besuch in dem besagten Schutzgebiet an, um einerseits offene Fragen gemeinsam zu erörtern und auch einen Eindruck von der Fläche vor Ort zu gewinnen. Zum Abschluss gibt es ein Gutachten, in dem ich darüber urteile, ob die Zertifizierungskriterien erfüllt sind. Auf dieser Grundlage stellt die IUCN dann das Zertifikat aus.
Was unterscheidet ein IUCN-zertifiziertes Wildnisgebiet von anderen Schutzgebieten in Deutschland?
Eine IUCN-Zertifizierung bedeutet, dass die Kriterien für die jeweilige Schutzgebietskategorie erfüllt werden. Bei einem Wildnisgebiet der Kategorie Ib bedeutet dies, dass das Gebiet ähnlich der Größe eines Nationalparks sein sollte (Kategorie Ia sind in der Regel viel kleinere Gebiete). Der Hauptschutzzweck muss die langfristige Wahrung der Integrität von natürlichen Flächen sein, die frei von einschlägiger menschlicher Aktivität sind. So ist es nicht zulässig, moderne Infrastruktur innerhalb des Gebietes zu errichten und es müssen natürliche Prozesse ungesteuert ablaufen können. Besuchende sind zugelassen, aber im Gegensatz zum Beispiel zu einem Nationalpark ohne weitere unterstützende Infrastruktur wie Toiletten oder ein Besucherzentrum. Stattdessen liegt die Besuchsqualität hier eindeutig in Einsamkeit und Stille. Die weitgehende Unerschlossenheit ist ein Qualitätsmerkmal von Wildnisgebieten.
Was motiviert Sie, diese Tätigkeit ehrenamtlich auszuführen?
Ich sehe meine Arbeit in erster Linie als Unterstützung für die Schutzgebietsarbeit vor Ort. Wir wollen miteinander arbeiten, das heißt, die Zertifizierungen sollten immer als Instrument verstanden werden, die eigene Arbeit noch weiter zu verbessern. Nicht selten geht es auch darum, über die Zertifizierung in den politischen Raum zu kommunizieren – entweder über das Erreichte oder aber mit dem Hinweis, dass eine Zertifizierung auch eine dauerhafte Verantwortung ist, die im schlechtesten Fall bei Nichterfüllung zu einer Rücknahme der Zertifizierung führt. Persönlich fasziniert mich an dem Thema Wildnis, dass die Natur über große (Selbst-)Heilungskräfte verfügt, denen wir Raum geben müssen – allein schon um der Erkenntnis willen, wie Prozesse ohne menschliches Einwirken verlaufen. Und im Kleinen freue ich mich bei jedem Schritt in der Natur darüber, dass ich gerade nicht im Schreibtisch sitze.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
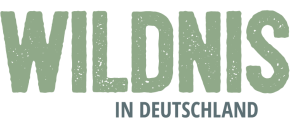





 © Hans‐Jörg Wilke
© Hans‐Jörg Wilke