Initiative Wildnis in Deutschland: Wie alles begann
Michael Brombacher von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt schreibt über die Anfänge der Initiative Wildnis in Deutschland

Michael Brombacher im Bayerischen Wald © Daniel Rosengren
Wann hat die Diskussion um mehr Wildnis in Deutschland eigentlich angefangen? Mit der Gründung der Initiative Wildnis in Deutschland 2015? Tatsächlich liegen die Ursprünge schon etwas weiter zurück, nämlich in der Gründungsphase des ersten deutschen Nationalparks im Bayerischen Wald vor knapp 60 Jahren. Der sollte zwar im Namen und Ruf dem Vorbild Yellowstone folgen, aber dass man einen Wald nicht mehr von Menschenhand gestaltet, das konnten sich nicht alle Akteure von damals vorstellen.
Zum ersten Mal echte Wildnis zugelassen haben Parkverwaltung und die damalige bayerische Landesregierung, als nach Gewitterstürmen 1983 und 1984 rund 170 Hektar an vom Menschen gepflanzten Fichten-Monokulturen vom Wind umgeworfen wurden. Nach langen Diskussionen hat man sich damals entschieden, die Stämme und Äste einfach liegen zu lassen, statt den Wald „aufzuräumen“ und neu zu pflanzen. Das erlaubte es erstmals, zu beobachten, wie sich die Fläche ohne menschliche Hilfe entwickelt, wie dort wieder Wald aus den Gestaltungskräften der Natur entsteht – die sogenannte Naturverjüngung des Waldes. Heute kann man beispielsweise am Seelensteig in Spiegelau ein solches Naturschauspiel bewundern. „Natur Natur sein lassen“: Dieses Motto prägte der damalige Nationalparkleiter Hans Biblriether. Auf den sich selbst überlassenen Flächen entwickelte sich Wildnis. Damit war die Diskussion darüber geboren, ob und wie „mehr Wildnis“ in einem dichtbesiedelten Land wie Deutschland möglich ist. Sie hat die weitere Entwicklung des Nationalparks Bayerischer Wald und aller 15 weiteren Nationalparks in Deutschland bestimmt, und wirkt auch darüber hinaus.
Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die Vertragsstaatenkonferenz der Übereinkunft zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt, die Deutschland 2008 als Gastgeber ausrichtete. Die damalige Bundesregierung präsentierte der Weltgemeinschaft damals eine ambitionierte Strategie, um den Zustand der Biodiversität im Land zu verbessern. Eines der festgeschriebenen Ziele lautete: Zwei Prozent Wildnis in Deutschland sollen möglich sein, und zwar zunächst bis 2020, später wurde 2030 festgelegt. Mit den damals bestehenden Nationalparks beziehungsweise deren Kernzonen und einigen kleineren Wildnisflächen (in Naturwaldreservaten oder auf ehemaligen Truppenübungsplätzen) kam man gerade mal auf 0,6 Prozent der Landesfläche. Allen war klar: Um dieses Ziel zu erreichen, ist viel gemeinsames Engagement nötig.
Wildnisgebiete gehören zu den wertvollsten Naturlandschaften, die wir auf der Erde haben. Weitgehend ungesteuerte natürliche Prozesse ermöglichen eine besondere Artenvielfalt. Wildnisgebiete sind aber auch wichtige Alliierte für uns Menschen im Umgang mit dem Klimawandel: natürliche Flusslandschaften halten das Wasser zurück, natürliche Waldböden speichern besonders viel Wasser und große Wälder kühlen die Luft spürbar ab.
Das Engagement für mehr Wildnis in Deutschland ruht daher auf vielen Schultern: Im Jahr 2015 kam erstmals unter der Leitung der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt 1858 e.V. eine Gruppe aus Naturschutzorganisationen für eine Auftaktsitzung in Berlin zusammen. Daraus entwickelt sich die Initiative Wildnis in Deutschland, die sich gemeinsam und koordiniert für mehr Wildnis engagiert. Die Initiative teilt die Überzeugung, dass sich eine so starke Volkswirtschaft wie Deutschland, vor allem auf seinen staatlichen Flächen, mehr dieser besonderen Naturschätze leisten kann. Das heißt, mehr Nationalparks, aber auch größere Wildnisgebiete in Flussauen, Mooren und im Gebirge sind möglich und erstrebenswert. Auch 2025 ist das Zwei-Prozent-Wildnisziel noch nicht erreicht. Aber jede einzelne neue Fläche zählt. Denn sie sind ein Geschenk an künftige Generationen, denen wir ursprüngliche Natur überlassen. Nicht nur deshalb sind sie das Engagement für mehr Wildnis in Deutschland allemal wert.
Michael Brombacher, Leiter des Europareferats der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt 1858 e.V.
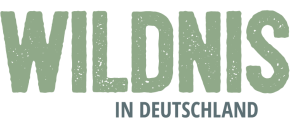

 © Ole Ruppel
© Ole Ruppel