30 Jahre Nationalpark Unteres Odertal
Mit der Gründung des Nationalparks Unteres Odertal 1995 erhielt die Flussauenlandschaft der Oder einen dauerhaften Schutz. Zum 1. Januar 2026 wird es ein verspätetes Geschenk geben: Dank Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens erfolgt auf 1.300 weiteren Hektar die endgültige Nutzungseinstellung. Dann gilt endlich auf mehr als der Hälfte der Fläche des Nationalparks: Natur Natur sein lassen.
Nationalparke sind die höchste Naturschutzkategorie der Großschutzgebiete in Deutschland: aktuell gibt es nur 16 Nationalparke in Deutschland. Der Nationalpark Unteres Odertal ist darunter der einzige Auennationalpark. Vor 30 Jahren wurde er gegründet.
Zwischen Euphorie und Herausforderungen: eine Nationalparkgründung ist komplex
Mit den politischen Veränderungen des Jahres 1990 begann für das untere Odertal eine neue Zeit. Trotz Regulierung des Flusses Oder, intensiver Landwirtschaft und industriellen Einflüssen konnte sich in der weiträumigen Oderniederung, die regelmäßig überflutetet wird, eine in Mitteleuropa selten gewordene Auenlandschaft erhalten.
Die Bedeutung dieses besonderen Gebiets wurde auch von Michael Succow erkannt, der den bereits zu DDR-Zeiten konzipierten Nationalpark Unteres Odertal mit in das DDR-Nationalparkprogramm aufnahm und die Vision eines deutsch-polnischen Nationalparks entwickelte. Die Aufnahme des Nationalparkprogramms in den deutschen Einigungsvertrag war ein Glücksfall: die Ausweisung des Nationalparks Unteres Odertal konnte so auch im wiedervereinigten Deutschland aufgegriffen werden und erfolgte im Jahr 1995.
Aber die euphorischen Anfänge des Nationalparks waren schnell von Herausforderungen geprägt. Ursprünglich war das Gebiet überwiegend in Privatbesitz und fast vollständig landwirtschaftlich genutzt. Die Eigentumsfrage zu klären war zentral für die Existenz des Nationalparks. Es wurden ein Naturschutzgroßprojekt und ein Flurbereinigungsverfahren gestartet.
Wildnis durch Bürokratie: Unternehmensflurbereinigungsverfahren
Das Flurbereinigungsverfahren hatte zum Ziel, Eigentums- und Nutzungskonflikte zu lösen. Im Jahr 2000 wurde die Flurbereinigung angeordnet, um private Eigentümer*innen aus dem Nationalpark herauszutauschen und Rechtsunsicherheiten zu klären. Es wurde zum größten Verfahren seiner Art: rund 20.000 Hektar Flurbereinigungsgebiet mit über 2.000 Beteiligten.
Anfangs gab es Proteste aus der Landwirtschaft, den Fischereien und von Jäger*innen, die teils um ihre Existenz fürchteten. Jedoch konnten diese Befürchtungen durch einen intensiven Beteiligungsprozess zerstreut werden. Heute ist der Nationalpark fest in der Region verankert: Besuchende und Einheimische profitieren von Veranstaltungen, touristischen Angeboten und verbesserter Infrastruktur.
Und nur mittels des Flurbereinigungsverfahrens kann das eigentliche Ziel des Nationalparks erreicht werden: im überwiegenden Teil des Nationalparks den Ablauf der Naturvorgänge ungesteuert vom Menschen zu ermöglichen.
Das Wildnisgebiet Unteres Odertal wächst
Zum 1. Januar 2026 wird das Verfahren endgültig abgeschlossen und der Nationalpark erhält ein verspätetes Jubiläumsgeschenk: 1.300 weitere Hektar werden aus der Nutzung genommen und der eigendynamischen Entwicklung überlassen. Erstmals wird somit die Zielvorgabe des Bundesnaturschutzgesetzes erreicht: In mehr als der Hälfte der Fläche des Nationalparks gilt dann: Natur Natur sein lassen.
Der Wert des Nationalparks Unteres Odertal
Der Nationalpark Unteres Odertal ist der einzige Nationalpark des Landes Brandenburg und der einzige Flussauennationalpark Mitteleuropas. Er erstreckt sich rund 50 Kilometer entlang der Oder und ist an seiner breitesten Stelle nur fünf Kilometer breit.
Das Spektrum der Lebensräume und Arten reicht von der Oder als bedeutendem Strom über deren schlammige teils sandige Flussufer über zahlreiche durchflossene oder abgeschnittene Altarme, Auenwiesen, Weichholz- und Hartholzauenwälder bis zu den artenreichen Laubmischwäldern sowie Trocken- und Halbtrockenrasen der Oderhänge.
Neben der Vielfalt an Lebensräumen ist der Nationalpark ein entscheidender Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Bis zu 10.000 Kraniche legen hier im Herbst einen Zwischenstopp ein. 35.000 rastende Blässgänse, 30.000 Saatgänse, 17.000 Stockenten, 15.000 Pfeifenten, 8.000 Krickenten und 9.000 Spießenten wurden von Ornithologen gezählt. Mehr als 160 Vogelarten brüten im Nationalpark: darunter See-, Fisch und Schreiadler aber auch Kraniche, Weiß- und Schwarzstörche. Auch andere Tierarten wie Fischotter oder Fischarten wie Schlammpeitzger und Steinbeißer sind auf den Nationalpark als Lebensraum angewiesen. Auch die Flora ist im Nationalpark besonders vielfältig: 1.186 Farn- und Blütenpflanzen wurden nachgewiesen. Mehr als 150 von diesen sind in Brandenburg gefährdet.
Ein Nationalpark in Zeiten des Klimawandels
Nicht nur für Pflanzen- und Tierarten, auch für den Menschen ist der Nationalpark zu Zeiten des Klimawandels ausgesprochen wertvoll: Im Sommer entwickelt sich ein kühlendes Klima mit einer höheren Luftfeuchtigkeit, im Winter wiederum werden niedrige Temperaturen gemildert. Damit erfüllt der Nationalpark eine bedeutende Regulation für extreme Witterungslagen, die auch auf den angrenzenden Raum, wie beispielsweise die Stadt Schwedt wirkt.
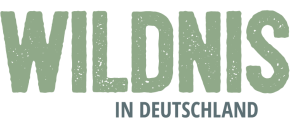

 © Arne Kolb / Nationalpark Schwarzwald
© Arne Kolb / Nationalpark Schwarzwald