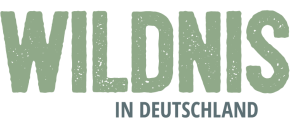United States-Germany Partnership on Wilderness
This partnership evolved from the World Wilderness Congress in August 2024 in South Dakota when German representatives approached U.S. Forest Service experts around collaborative wilderness work. The broad goal of a US-Germany Partnership on Wilderness (US-G PAW) is to foster knowledge exchange through joint research, on-the-ground learning with the sharing of case studies, and training via workshops and webinars. With knowledge exchange, mutually-beneficial and desired outcomes around wilderness designation which include progress towards increased management capacity, acceptance, and addressing persistent management issues (e.g., recreation management, wildfires and invasive species, and restoration and rewilding).
Deutsch-amerikanische Wildnis-Partnerschaft
Die Deutsch-Amerikanische Wildnis-Partnerschaft (US-G PAW) entstand beim 12. World Wilderness Congress in South Dakota im August 2024. Deutsche Wildnisexpertinnen*Wildnisexperten kamen auf ihre Kollegen*Kolleginnen vom U.S. Forest Service zu und regten einen bilateralen Austausch zum Thema Wildnis an. Ziel der Partnerschaft ist der Wissensaustausch, die Initiierung gemeinsamer Forschungsprojekte sowie die Weiterbildung durch Workshops und Webinare. Die Partnerschaft soll dazu beitragen, mehr Wildnis zu schaffen, die Akzeptanz für Wildnis in der Bevölkerung zu steigern und Managementkapazitäten aufzubauen (z.B. bei Besucherlenkung, Waldbränden oder invasiven Arten).